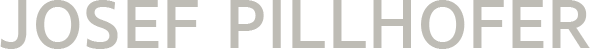Josef Pillhofer über Natur, Wirklichkeit, Reduktion, Abstraktion, Arbeitsprozess
Aus einem längeren Gespräch mit Josef Pillhofer am 18. März 2003, zusammengestellt von Siegwald Ganglmair und abgedruckt im Kunstmagazin PARNASS 2003, Heft 2, S. 90 – 96.
Josef Pillhofer
Ich bin damit sehr einverstanden, [über einige zentrale Begriffe in meinem Werk zu reden], weil die künstlerische Arbeit eigentlich sehr geheimnisvoll ist, da komm ich jetzt immer mehr darauf, und wenn man darüber reflektiert, müsste man äußerst sensibel über die Empfindungen reden, und die Empfindungen sind nicht so sehr an das Äußere gebunden, an Ereignisse, sondern eher an das Wesen des Ausgangspunkts und an das, was mich im Besonderen an Wirklichkeit fasziniert, leidenschaftlich bewegt – das ist der Ausgangspunkt.
Der Abstand ermöglicht mir einerseits, einfacher über das zu reden, was ich mache bzw. gemacht habe, andererseits noch wesentlich komplexere Aussagen zu machen. Es zeigt sich jetzt in meinem höheren Alter auch, dass sich meine frühe Zeit und meine spätere Zeit, also diese beiden Zeiten jetzt wieder stärker begegnen. Also das, was ich jetzt im Grunde tu, mein Verhältnis zu meiner Arbeit und Realität ist ähnlich dem meiner frühesten Jugend. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, war immer in Kontakt mit den Wäldern meiner Umgebung, mit den Dingen, mit der Natur, insbesondere als Bildhauer mit der menschlichen Figur. Ich hab schon sehr früh porträtiert, meine Eltern gezeichnet. Das Zeichnen ist mir von Anfang an ein großes Anliegen gewesen, und zwar wirklich das Zeichnen vor der Natur, ich würde das noch viel einfacher formulieren: das Abzeichnen – etwas, das man kaum mehr sagen darf; also nicht, dass man von vornherein sofort mit großen Begriffen kommt. Natürlich kann man sagen: was man nicht in sich sieht, sieht man auch nicht vor der Natur, das bleibt bestehen, aber selbst diesen Ansatz müsste man löschen, dass man im Grunde fast das Unmögliche tut und versucht, seine Empfindungen, die man aus der Wirklichkeit hat, im Medium des Zeichnens oder der Skulptur zu verwirklichen.
Der Arbeitsprozess ist ein sehr vielschichtiger, je vielschichtiger er wird, umso einfachere Begriffe müssten dann gefunden werden, und diese Begriffe haben sehr viel mit dem Maß zu tun. Es gibt einen Maßkanon, der wahrscheinlich jedem Künstler eigen ist, und in Bezug auf dieses Maß, das man in sich hat, setzt man auch die Maße seiner Arbeit. Wenn man meine Arbeiten genauer untersucht, wird man wahrscheinlich immer auf ähnliche Maße stoßen, ähnliche Winkel finden, es gibt eine Vorliebe für gewisse Winkel, gewisse Akzente, für gewisse Formen, und die will man natürlich oft einbringen. – Ich selber hab immer vor der Natur gezeichnet, und ich tu es auch jetzt noch, viele sagen, du vergeudest deine Zeit damit, du hast es gemacht, du kannst es ohnehin schon, ich bin jedoch der Überzeugung, auch aufgrund meiner Erfahrung, dass ich es immer weniger kann, weil die Vielfalt dessen, was Wirklichkeit ist oder was beispielsweise die menschliche Figur ist, so enorm ist, einerseits, und andererseits auch wieder hin tendiert zu einer möglichst einfachen Sprache, Bildsprache. Dieser Widerspruch ist etwas, der wichtig ist und den man nie verlieren soll, sonst gerät man sehr leicht in eine Arbeitsweise, die eindimensional wird, man beginnt zu reduzieren, man wird immer einfacher, zu gleicher Zeit muss man aber doch auch wissen oder empfinden, welcher Verlust damit verbunden ist. Sicher, eine größere Klarheit, zumindest eine formale Klarheit ist eher gegeben, wenn man einfach wird, wenn aber das Einfache nicht das Komplizierte in sich schließt, wird es simpel. Und das kann man bei vielen Ergebnissen in der Kunstgeschichte feststellen. Vielleicht ist es am besten, wenn ich den Vorgang vor dem Modell beschreibe. Ein Modell ist für mich nicht nur etwas rein Gegenständliches, das man dann objektiviert, sondern ein Modell ist etwas Lebendiges, das in dem Augenblick, da man damit konfrontiert ist, ganz andere Assoziationen hervorruft, Assoziationen der Empfindung, der Erscheinung, der Schönheit, des Erotischen.
Die frühe Zeit meiner Kindheit war sehr bestimmt von meiner Familie mütterlicherseits. Meine Mutter hat gern und gut gemalt, und es gibt Verwandte, die Maler und Künstler waren, also insofern war ich mit dem Bildnerischen schon von Kindheit an befasst und begeistert dafür. Die Mutter hat recht perfekt gemalt, sie hat Techniken gehabt, sie hat genau gewusst, wie man was abschattiert, kurz, sie kannte die Regeln, die es so gibt. Mir war das eher hinderlich, ich hab nach meiner Empfindung ziemlich offen und ohne jede künstlerische Schule gezeichnet, was dabei herausgekommen ist, war in der Tat sehr naiv. Und was bei mir sehr früh noch zum Tragen kam: Meine Eltern haben mir Bücher geschenkt, in denen die bildende Kunst dokumentiert war, und ich war somit seit dem zwölften, dreizehnten Lebensjahr mit der klassischen Kunst konfrontiert. Das waren für mich durchaus Vorbilder. Der Widerspruch zu dem Geformten ist der, dass ich mit meiner unmittelbaren Empfindung vor der Natur da überhaupt nichts anfangen konnte. Meine Mutter war auch sehr früh mit mir in Graz, einmal war eine große Ambrosi-Ausstellung, die wollte sie mir zeigen, und ich war davon total begeistert. Nur bin ich sehr bald draufgekommen: die Begeisterung ist eher drangelegen, was man machen kann mit dem Medium der Skulptur, mit dem Plastischen, der Bewegung.
Ich habe also vor der Natur zu zeichnen begonnen, vor allem Landschaften, Köpfe, und habe mir parallel dazu etwas ganz Bestimmtes aus der Kunstgeschichte ausgesucht, z.B. die chinesische Landschaftszeichnung, auch die Zeichnung des Courbet, des Caspar David Friedrich, also Zeichnungen, wo die Transformation in abstrakte oder stilistische Begriffe gering war, wo man fast sagen könnte, es waren Auseinandersetzungen mit den Phänomenen der Natur und dem Meditativen. Das war früh so, und das ist auch jetzt noch so. Insofern suche ich immer wieder Modelle, denn ich kann kaum ein reduzierteres Problem, etwas Einfaches angehen, wenn ich nicht parallel dazu immer wieder diese fast verrückte Auseinandersetzung mit der komplexen Wirklichkeit habe, die mich natürlich stört, sie ist ein Störfaktor, der für mich jedoch lebensnotwendig ist, weil ich schon aus meiner langen Erfahrung gesehen hab, dass sich sehr schnell etwas verselbständigt, sich vielleicht auch allzu rasch reduziert, aus meiner Sicht zu einfachen abstrakten Begriffen führt, die natürlich in der Moderne eher akzeptiert werden als etwas Kompliziertes, das auch fragmentarisch ist, eindimensional, und in einer unglaublichen Weise wiederholt, perpetuiert, variiert wird. Was jedoch bei einer solchen Reduktion impliziert wird, das ist meiner Meinung nach das Entscheidende. Von meiner Empfindung her schließt ein Mondrian das alles ein, es ist aber auch von seinem Leben und seiner künstlerischen Entwicklung her bekannt, wie er zu seinen Waagrechten und Senkrechten gekommen ist, diese Vorgeschichte muss man wissen. Vielfach wird ja sofort mit einem bereits reduzierten Formkanon begonnen, der unausweichlich ist.
Weil ich auf das Römische Mädchen angesprochen wurde, wo die Begriffe Natur und Reduktion, die bei mir nebeneinander auftreten, eine gewisse Annäherung erfahren – das ist eine sehr komplexe Angelegenheit gewesen. Ausgegangen bin ich eigentlich auch von Vorbildern, vielfach ist es ja so, dass die wenigsten jüngeren Künstler sich an Vorbilder halten, ich halte das für außerordentlich bedauerlich, für mich war in der Skulptur ein ganz wichtiges Vorbild der Bildhauer Maillol, auch Lehmbruck. Bevor ich näher auf das Römische Mädchen eingehe, möchte ich eine ganz frühe Kastanienholzfigur von mir erwähnen, 1946 entstanden, das war ein Baum, der bei unserem Haus gestanden ist, der zugeschnitten worden ist, aus dem habe ich dann das frühe stehende Mädchen mit den Armen nach oben geschnitzt, übrigens in einem ganz kleinen Raum, das war die alte Bienenhütte meines Vaters; ich hab das Holz gerade noch in die Hütte hineingekriegt, das war wie in einer Zelle, wo ich so konfrontiert war mit dem Holz und meinen Gedanken, mit dem, was ich wollte, so dass dies eigentlich sehr zuträglich war für eine kontinuierliche, lange Arbeit. Was entstanden ist, ist natürlich in einer gewissen vorbildhaften Abhängigkeit im positiven Sinn von den Arbeiten des Maillol gewesen, und der Unterschied zu meiner späten Arbeit, zum so genannten Römischen Mädchen, ist ein ganz entscheidender. Da ist für mich etwas wichtig geworden, nämlich die Auseinandersetzung mit dem konkreten Modell, mit der konkreten Person, und die konkrete Person ist etwas ganz spezifisch Persönliches, während bei dieser recht frühen Skulptur, die ich in Holz gemacht hab, ohne Modell, für mich die Modellvorstellung Skulpturen waren, die es in der plastischen Kunstgeschichte gibt. Eine Zeitlang habe ich selbst griechische Vorbilder modelliert, da gibt es einige Beispiele. Die Vorbilder waren mir also sehr wichtig. Aber zur selben Zeit war meine Faszination der Natur gegenüber wahrscheinlich noch größer und wichtiger als eine allzu schnelle Formfindung. Ich habe zum Römischen Mädchen vor Beginn der plastischen Arbeit sehr viele lebensgroße Zeichnungen gemacht, habe ganz genau die Abstände der Hände bestimmt, die Parallelität, links und rechts einigermaßen gleich, dann das Geradestehen, und zwar so, dass das Stehen das deutlichste Stehen wird, das man sich vorstellt, denn ein wirkliches Stehen ist nicht so, dass man die Beine ganz beisammen hat, sondern etwas auseinander, so steht man besser, die beiden Beine sind dann wie zwei Säulen, und die Hände etwas weg von den Oberschenkeln, wenn sie herunter hängen, insofern kriegen sie da einen ganz anderen Charakter, so dass die Extremitäten frei erfahrbar sind und das Stehen, also das Säulenhafte, noch deutlicher wird. Und da hat es sich auch ergeben, dass sich dabei ein gewisser Form- und Maßkanon automatisch eingestellt hat, den man reflektiv untersuchen kann. Ich halte das Römische Mädchen auch deswegen für wichtig, weil es das Aktuellste ist, ich würde fast meinen, es ist so aktuell, weil es frei ist von gesellschaftsbezogenen Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit. Man könnte genau so gut sagen, das ist das porträthafte Non-Plus-Ultra, wobei man auch sagen muss, je näher man an die Wirklichkeit herankommt, umso mehr wird einem bewusst, wie unmöglich es ist, überhaupt etwas realistisch zu machen. Ich habe allerdings parallel dazu sehr reduziert gearbeitet, ich habe große Lust an Formzusammenhängen, die bis zur Architektur und zum Räumlichen reichen, mir ist aber bewusst, dass das nicht das eigentliche, tiefste Anliegen meiner Arbeit ist, obwohl ich damit eher bekannt geworden bin, weil das in der Zeit so war, in der die so genannte abstrakte Kunst aktuell war, da habe ich mit meinen Skulpturen etwas bewirkt, zum Unterschied von vielen, die das äußerlich, dekorativ gemacht haben. Und man sieht, so hoffe ich, an diesen reduzierten Arbeiten doch sehr deutlich diesen Rückbezug zur Komplexität dessen, was ich vorher gemacht habe, das ist in ihnen, das ist vielleicht das, was meine Arbeiten auszeichnet: Es ist nicht a priori etwas Abstraktes gemacht worden.
Wichtig ist mir auch bei meiner Arbeit, dass die erste unmittelbare Empfindung bis zur endgültigen Lösung einer Aufgabe noch bestimmend ist und nicht verloren geht und nicht gelöscht wird durch plötzliche Einbrüche von dort und da, dass dieser Rückbezug zu Beginn auch noch am Schluss spürbar wird.
Aus einem längeren Gespräch mit Josef Pillhofer am 18. März 2003, zusammengestellt von Siegwald Ganglmair und abgedruckt im Kunstmagazin PARNASS 2003, Heft 2, S. 90 – 96.
Josef Pillhofer
Ich bin damit sehr einverstanden, [über einige zentrale Begriffe in meinem Werk zu reden], weil die künstlerische Arbeit eigentlich sehr geheimnisvoll ist, da komm ich jetzt immer mehr darauf, und wenn man darüber reflektiert, müsste man äußerst sensibel über die Empfindungen reden, und die Empfindungen sind nicht so sehr an das Äußere gebunden, an Ereignisse, sondern eher an das Wesen des Ausgangspunkts und an das, was mich im Besonderen an Wirklichkeit fasziniert, leidenschaftlich bewegt – das ist der Ausgangspunkt.
Der Abstand ermöglicht mir einerseits, einfacher über das zu reden, was ich mache bzw. gemacht habe, andererseits noch wesentlich komplexere Aussagen zu machen. Es zeigt sich jetzt in meinem höheren Alter auch, dass sich meine frühe Zeit und meine spätere Zeit, also diese beiden Zeiten jetzt wieder stärker begegnen. Also das, was ich jetzt im Grunde tu, mein Verhältnis zu meiner Arbeit und Realität ist ähnlich dem meiner frühesten Jugend. Ich bin auf dem Land aufgewachsen, war immer in Kontakt mit den Wäldern meiner Umgebung, mit den Dingen, mit der Natur, insbesondere als Bildhauer mit der menschlichen Figur. Ich hab schon sehr früh porträtiert, meine Eltern gezeichnet. Das Zeichnen ist mir von Anfang an ein großes Anliegen gewesen, und zwar wirklich das Zeichnen vor der Natur, ich würde das noch viel einfacher formulieren: das Abzeichnen – etwas, das man kaum mehr sagen darf; also nicht, dass man von vornherein sofort mit großen Begriffen kommt. Natürlich kann man sagen: was man nicht in sich sieht, sieht man auch nicht vor der Natur, das bleibt bestehen, aber selbst diesen Ansatz müsste man löschen, dass man im Grunde fast das Unmögliche tut und versucht, seine Empfindungen, die man aus der Wirklichkeit hat, im Medium des Zeichnens oder der Skulptur zu verwirklichen.
Der Arbeitsprozess ist ein sehr vielschichtiger, je vielschichtiger er wird, umso einfachere Begriffe müssten dann gefunden werden, und diese Begriffe haben sehr viel mit dem Maß zu tun. Es gibt einen Maßkanon, der wahrscheinlich jedem Künstler eigen ist, und in Bezug auf dieses Maß, das man in sich hat, setzt man auch die Maße seiner Arbeit. Wenn man meine Arbeiten genauer untersucht, wird man wahrscheinlich immer auf ähnliche Maße stoßen, ähnliche Winkel finden, es gibt eine Vorliebe für gewisse Winkel, gewisse Akzente, für gewisse Formen, und die will man natürlich oft einbringen. – Ich selber hab immer vor der Natur gezeichnet, und ich tu es auch jetzt noch, viele sagen, du vergeudest deine Zeit damit, du hast es gemacht, du kannst es ohnehin schon, ich bin jedoch der Überzeugung, auch aufgrund meiner Erfahrung, dass ich es immer weniger kann, weil die Vielfalt dessen, was Wirklichkeit ist oder was beispielsweise die menschliche Figur ist, so enorm ist, einerseits, und andererseits auch wieder hin tendiert zu einer möglichst einfachen Sprache, Bildsprache. Dieser Widerspruch ist etwas, der wichtig ist und den man nie verlieren soll, sonst gerät man sehr leicht in eine Arbeitsweise, die eindimensional wird, man beginnt zu reduzieren, man wird immer einfacher, zu gleicher Zeit muss man aber doch auch wissen oder empfinden, welcher Verlust damit verbunden ist. Sicher, eine größere Klarheit, zumindest eine formale Klarheit ist eher gegeben, wenn man einfach wird, wenn aber das Einfache nicht das Komplizierte in sich schließt, wird es simpel. Und das kann man bei vielen Ergebnissen in der Kunstgeschichte feststellen. Vielleicht ist es am besten, wenn ich den Vorgang vor dem Modell beschreibe. Ein Modell ist für mich nicht nur etwas rein Gegenständliches, das man dann objektiviert, sondern ein Modell ist etwas Lebendiges, das in dem Augenblick, da man damit konfrontiert ist, ganz andere Assoziationen hervorruft, Assoziationen der Empfindung, der Erscheinung, der Schönheit, des Erotischen.
Die frühe Zeit meiner Kindheit war sehr bestimmt von meiner Familie mütterlicherseits. Meine Mutter hat gern und gut gemalt, und es gibt Verwandte, die Maler und Künstler waren, also insofern war ich mit dem Bildnerischen schon von Kindheit an befasst und begeistert dafür. Die Mutter hat recht perfekt gemalt, sie hat Techniken gehabt, sie hat genau gewusst, wie man was abschattiert, kurz, sie kannte die Regeln, die es so gibt. Mir war das eher hinderlich, ich hab nach meiner Empfindung ziemlich offen und ohne jede künstlerische Schule gezeichnet, was dabei herausgekommen ist, war in der Tat sehr naiv. Und was bei mir sehr früh noch zum Tragen kam: Meine Eltern haben mir Bücher geschenkt, in denen die bildende Kunst dokumentiert war, und ich war somit seit dem zwölften, dreizehnten Lebensjahr mit der klassischen Kunst konfrontiert. Das waren für mich durchaus Vorbilder. Der Widerspruch zu dem Geformten ist der, dass ich mit meiner unmittelbaren Empfindung vor der Natur da überhaupt nichts anfangen konnte. Meine Mutter war auch sehr früh mit mir in Graz, einmal war eine große Ambrosi-Ausstellung, die wollte sie mir zeigen, und ich war davon total begeistert. Nur bin ich sehr bald draufgekommen: die Begeisterung ist eher drangelegen, was man machen kann mit dem Medium der Skulptur, mit dem Plastischen, der Bewegung.
Ich habe also vor der Natur zu zeichnen begonnen, vor allem Landschaften, Köpfe, und habe mir parallel dazu etwas ganz Bestimmtes aus der Kunstgeschichte ausgesucht, z.B. die chinesische Landschaftszeichnung, auch die Zeichnung des Courbet, des Caspar David Friedrich, also Zeichnungen, wo die Transformation in abstrakte oder stilistische Begriffe gering war, wo man fast sagen könnte, es waren Auseinandersetzungen mit den Phänomenen der Natur und dem Meditativen. Das war früh so, und das ist auch jetzt noch so. Insofern suche ich immer wieder Modelle, denn ich kann kaum ein reduzierteres Problem, etwas Einfaches angehen, wenn ich nicht parallel dazu immer wieder diese fast verrückte Auseinandersetzung mit der komplexen Wirklichkeit habe, die mich natürlich stört, sie ist ein Störfaktor, der für mich jedoch lebensnotwendig ist, weil ich schon aus meiner langen Erfahrung gesehen hab, dass sich sehr schnell etwas verselbständigt, sich vielleicht auch allzu rasch reduziert, aus meiner Sicht zu einfachen abstrakten Begriffen führt, die natürlich in der Moderne eher akzeptiert werden als etwas Kompliziertes, das auch fragmentarisch ist, eindimensional, und in einer unglaublichen Weise wiederholt, perpetuiert, variiert wird. Was jedoch bei einer solchen Reduktion impliziert wird, das ist meiner Meinung nach das Entscheidende. Von meiner Empfindung her schließt ein Mondrian das alles ein, es ist aber auch von seinem Leben und seiner künstlerischen Entwicklung her bekannt, wie er zu seinen Waagrechten und Senkrechten gekommen ist, diese Vorgeschichte muss man wissen. Vielfach wird ja sofort mit einem bereits reduzierten Formkanon begonnen, der unausweichlich ist.
Weil ich auf das Römische Mädchen angesprochen wurde, wo die Begriffe Natur und Reduktion, die bei mir nebeneinander auftreten, eine gewisse Annäherung erfahren – das ist eine sehr komplexe Angelegenheit gewesen. Ausgegangen bin ich eigentlich auch von Vorbildern, vielfach ist es ja so, dass die wenigsten jüngeren Künstler sich an Vorbilder halten, ich halte das für außerordentlich bedauerlich, für mich war in der Skulptur ein ganz wichtiges Vorbild der Bildhauer Maillol, auch Lehmbruck. Bevor ich näher auf das Römische Mädchen eingehe, möchte ich eine ganz frühe Kastanienholzfigur von mir erwähnen, 1946 entstanden, das war ein Baum, der bei unserem Haus gestanden ist, der zugeschnitten worden ist, aus dem habe ich dann das frühe stehende Mädchen mit den Armen nach oben geschnitzt, übrigens in einem ganz kleinen Raum, das war die alte Bienenhütte meines Vaters; ich hab das Holz gerade noch in die Hütte hineingekriegt, das war wie in einer Zelle, wo ich so konfrontiert war mit dem Holz und meinen Gedanken, mit dem, was ich wollte, so dass dies eigentlich sehr zuträglich war für eine kontinuierliche, lange Arbeit. Was entstanden ist, ist natürlich in einer gewissen vorbildhaften Abhängigkeit im positiven Sinn von den Arbeiten des Maillol gewesen, und der Unterschied zu meiner späten Arbeit, zum so genannten Römischen Mädchen, ist ein ganz entscheidender. Da ist für mich etwas wichtig geworden, nämlich die Auseinandersetzung mit dem konkreten Modell, mit der konkreten Person, und die konkrete Person ist etwas ganz spezifisch Persönliches, während bei dieser recht frühen Skulptur, die ich in Holz gemacht hab, ohne Modell, für mich die Modellvorstellung Skulpturen waren, die es in der plastischen Kunstgeschichte gibt. Eine Zeitlang habe ich selbst griechische Vorbilder modelliert, da gibt es einige Beispiele. Die Vorbilder waren mir also sehr wichtig. Aber zur selben Zeit war meine Faszination der Natur gegenüber wahrscheinlich noch größer und wichtiger als eine allzu schnelle Formfindung. Ich habe zum Römischen Mädchen vor Beginn der plastischen Arbeit sehr viele lebensgroße Zeichnungen gemacht, habe ganz genau die Abstände der Hände bestimmt, die Parallelität, links und rechts einigermaßen gleich, dann das Geradestehen, und zwar so, dass das Stehen das deutlichste Stehen wird, das man sich vorstellt, denn ein wirkliches Stehen ist nicht so, dass man die Beine ganz beisammen hat, sondern etwas auseinander, so steht man besser, die beiden Beine sind dann wie zwei Säulen, und die Hände etwas weg von den Oberschenkeln, wenn sie herunter hängen, insofern kriegen sie da einen ganz anderen Charakter, so dass die Extremitäten frei erfahrbar sind und das Stehen, also das Säulenhafte, noch deutlicher wird. Und da hat es sich auch ergeben, dass sich dabei ein gewisser Form- und Maßkanon automatisch eingestellt hat, den man reflektiv untersuchen kann. Ich halte das Römische Mädchen auch deswegen für wichtig, weil es das Aktuellste ist, ich würde fast meinen, es ist so aktuell, weil es frei ist von gesellschaftsbezogenen Auseinandersetzungen mit der Wirklichkeit. Man könnte genau so gut sagen, das ist das porträthafte Non-Plus-Ultra, wobei man auch sagen muss, je näher man an die Wirklichkeit herankommt, umso mehr wird einem bewusst, wie unmöglich es ist, überhaupt etwas realistisch zu machen. Ich habe allerdings parallel dazu sehr reduziert gearbeitet, ich habe große Lust an Formzusammenhängen, die bis zur Architektur und zum Räumlichen reichen, mir ist aber bewusst, dass das nicht das eigentliche, tiefste Anliegen meiner Arbeit ist, obwohl ich damit eher bekannt geworden bin, weil das in der Zeit so war, in der die so genannte abstrakte Kunst aktuell war, da habe ich mit meinen Skulpturen etwas bewirkt, zum Unterschied von vielen, die das äußerlich, dekorativ gemacht haben. Und man sieht, so hoffe ich, an diesen reduzierten Arbeiten doch sehr deutlich diesen Rückbezug zur Komplexität dessen, was ich vorher gemacht habe, das ist in ihnen, das ist vielleicht das, was meine Arbeiten auszeichnet: Es ist nicht a priori etwas Abstraktes gemacht worden.
Wichtig ist mir auch bei meiner Arbeit, dass die erste unmittelbare Empfindung bis zur endgültigen Lösung einer Aufgabe noch bestimmend ist und nicht verloren geht und nicht gelöscht wird durch plötzliche Einbrüche von dort und da, dass dieser Rückbezug zu Beginn auch noch am Schluss spürbar wird.